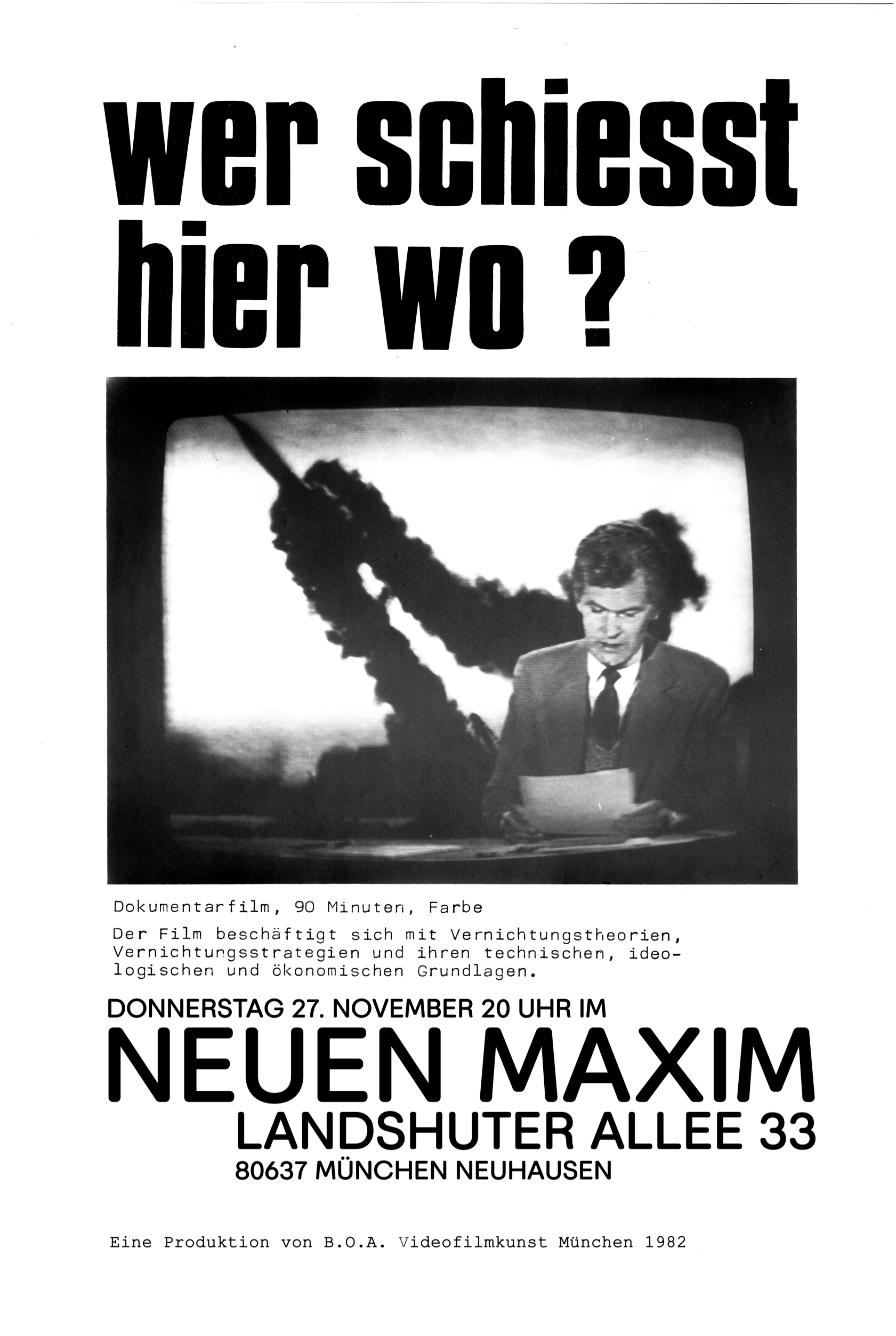„Wer schießt hier wo“
Ums Überleben - Die Videodokumentation
Süddeutsche Zeitung vom Freitag‚ 23. Juli 1982
Ob man eine Odelgrube zu einem Atombunker umbauen könne? Der Experte am Telephon
empfiehlt dem Anrufer, wegen der möglicherweise giftigen Gase doch lieber den Keller des
Nachbarn aufzusuchen. Eine Mutter, besorgt darüber, daß bei einem Atomschlag die Kinder
in der Schule von ihr abgeschnitten seien, beruhigt der Experte mit dem Hinweis, daß dem
Ernstfall doch immer eine Vorbereitungszeit in Form einer Krise vorausgehe. Deutlich
erleichtert hängt die Frau den Hörer auf. Diese Frage- und Antwortspiele zur Atombombe
stammen aus der BR-Hörfunksendung „Das Notizbuch”, und sie muten nicht weniger absurd
an als der Ausschnitt aus einem amerikanischen Schulungsfilm der fünfziger Jahre, der das
Überleben bei einem Picknick demonstriert: Die Familie wirft Geschirr und Essen in die Luft
und kriecht unter die Tischdecke.
Solche Szenen finden sich in dem Dokumentarfilm Wer schießt hier wo der Videokooperative
B.O.A, der zunächst einmal eindringlich klarmacht, daß sich die Waffentechnologie in den
knapp vierzig Jahren, in denen wir mit der Bombe leben, ständig weiterentwickelt hat,
während das Gespräch über den Schutz der Zivilbevölkerung auf dem Stand von 1950
stehengeblieben ist. Aus dieser Einsicht ergibt sich aber nicht die Forderung nach einem
effektiveren Zivilschutz: die Vernichtungswaffen sind mittlerweile so schnell einsetzbar, so
zielgenau und von solcher Zerstörungswirkung, daß Schutzmaßnahmen von vorneherein
sinnlos wären. Das einzige Mittel gegen den Atomkrieg: ihn verhindern. Angesichts der
„Machbarkeit“ kleiner, begrenzter Atomkriege ist, wie Robert Jungk es in dieser
Dokumentation formuliert, die Friedens- zu einer Überlebensbewegung geworden.
Zu zeigen, wie und warum wir von Rüstung abhängig sind, und welch neue Abhängigkeıten
das Weiterrüsten wiederum mit sich bringt – darum vor allem geht es in Wer schießt hier wo.
Die Dokumentation arbeitet zum größten Teil mit Material aus dem deutschen Fernsehen; es
zeigt auf bestürzende Weise, wie oft da auch bei kritisch gemeinten Beiträgen Bilder
verwendet werden, die die Ästhetik moderner Waffensysteme herausstellen. Aber es finden
sich auch Ausschnitte aus Sendungen, die man nicht oft genug zeigen kann: Etwa das
Interview mit einem der Väter der Neutronenbombe, der ganz sachlich erläutert, daß diese
Waffe nie für die Verteidigung, sondern von Anfang an für den Angriff gedacht war. Genau
darin liegt das besondere Verdienst der Dokumentation: Öffentlich zwar zugängliche aber
sonst zu sehr verstreute Informationen zu versammeln und daraus neue Einsichten zu
gewinnen. Mit dem von Videogruppen gedrehten Material von den jüngsten
Friedensdemonstrationen in München, Bonn und Berlin werden schließlich die Dunkelstellen
der offiziellen Berichterstattung ausgeleuchtet.
Wer schießt hier wo spiegelt den aktuellen Stand der Debatte und stellt Zusammenhänge
her, wie sie so im Fernsehen nicht zu sehen sind. Die Dokumentation ist deshalb auch ein
gelungenes Beispiel dafür, wie sich Gruppen, die kaum Zugang zu den Medien haben, selbst
Öffentlichkeit schaffen können. (In München im Werkstattkino, eine Kassette mit der
Dokumentation kann bei der Videokooperative B.O.A. ausgeliehen werden.)
CHRISTIAN BAUER, Süddeutsche Zeitung
Mit Video gegen Nachrüstung:
»Wer schießt hier wo?«
Taz vom Mittwoch, 07. Juli 1982
Ein hoher Anspruch: In 90 Minuten Dokumentarfilm die technischen, ideologischen und
politischen Grundlagen der atomaren Nachrüstung darzustellen. Doch ist es den Filmern
angesichts der Vielschichtigkeit des Themas gut gelungen, weder zu sehr zu verwirren noch
zu sehr zu vereinfachen.
Ausgehend von der sachlich gehaltenen Darstellung der waffentechnischen Bedeutung der
cruise missiles, Pershing, der Neutronenwaffe und den Folgen eines atomaren Angriffs,
kommt der Film zu den ökonomischen Interessen hinter der Rüstungsproduktion und deren
politischer Durchsetzung. Spätestens im letzten Teil, wenn Aufnahmen von
Friedensdemonstrationen und Straßenkämpfen gezeigt werden, wird das politische
Interesse der Filmer klar: Sie wollen Engagement wecken. Ein Film, nachdem man /frau nicht
frustriert nach Hause geht, sondern noch gerne weiter diskutieren will.
Produktion und Verleih B.0.A. Video-Kooperative München
Rainer, taz-München
Wer schießt hier wo?
Produktion: B. O. A. Videokooperative, München 1982, 90 Min., Farbe.
Das Video dokumentiert die Geschichte der Massenvernichtungswaffen vom zweiten
Weltkrieg bis zum Falklandkrieg. Es beschäftigt sich mit Vernichtungstheorien,
Vernichtungsstrategien und Vernichtungssystemen. Es zeigt die technischen, ökonomischen
und ideologischen Grundlagen von Produktion und Anwendung dieser Waffen.
Teil 1: Die Überlebenden werden die Toten beneiden.
Die Totenscheine für den dritten Weltkrieg sind schon gedruckt, die Vernichtungswaffen
genauestens erprobt. Die Bevölkerung wird in Rundfunkmagazinen über
Selbstschutzmaßnahmen im Falle eines Atomkrieges ‘aufgeklärt‘: „Am besten hilft
Hinlegen!“ Experten erörtern die Frage ‚‚Schützt eine Jauchegrube?“ Es wird gezeigt, wie
sogenannte ‘begrenzte Atomkriege‘ mit Hilfe der neuen ‘kleinen und sauberen‘ Atomwaffen
wie z. B. Cruise Missile vorbereitet werden. Ein Kriegsszenario mit den Konsequenzen der
Neutronenwaffe und der Pershing-Rakete wird mit teils noch nicht gezeigten Aufnahmen
aufgeblättert.
Teil 2: Reklamefahrten zur Hölle
Die US-amerikanische Begründung der„‚Nach“rüstung basiert auf dem Argument der
Raketenlücke. Dem entgegen zeigt das Video, wie die Geschäfte mit der ‘nationalen
Sicherheit‘ funktionieren, wie Politik und Informationsmedien von den Interessen und der
Eigendynamik weltweit operierender Rüstungskonzerne geprägt werden. Die Ökonomischen
Hintergründe reflektiert Ernest Mandel in einem Referat über „Rüstungsproduktion unter
den Bedingungen einer Dauererwerbslosigkeit‘.
Teil 3: Es gibt nur einen Schutz gegen den Atomkrieg: ihn zu verhindern.
Die Frage des Widerstands gegen die drohende Massenvernichtung wird anhand von
Friedensinitiativen, Manifestationen und gewaltfreien Aktionen diskutiert.
Dieses Video — eine eindrucksvolle Zusammenstellung aus Material von ARD und ZDF —
befasst sich mit den zerstückelten Informationen für die Fernsehöffentlichkeit. Die
‚Erfahrungen aus zweiter Hand', wie sie ‘Tagesschau‘ und “Heute‘ bieten, werden wieder auf
die konkreten Lebens- und Erfahrungszusammenhänge zurückgeführt. Die Rekonstruktion
einer unterschlagenen und verschleierten Wirklichkeit ist faszinierend. Atemberaubend und
irritierend werden die Wünsche, Phantasien und Produkte der Waffenproduzenten
geschildert. Die gegenwärtige Debatte über die Wirkung von Mittelstreckenraketen
erscheint dagegen als Gespräch beim Kaffeekränzchen, während sich die Friedensinitiativen
hierzulande an der kommenden Generation der US-amerikanischen Raketensysteme und
Vernichtungspotentiale abarbeiten, werden in den Forschungszentren, auf Börsen und
Waffenmessen schon die nächste und übernächste Generation von Waffensystemen
geplant, als Prototyp hergestellt und finanziert.
Ein Video, das durch seine Eindeutigkeit überzeugend wirkt und das genügend
Diskussionsstoff liefert. Wer schießt hier wo? spiegelt den aktuellen Stand der Dinge und
stellt Zusammenhänge her, wie sie in der Bundesrepublik in einer so durchdachten
Radikalität bisher nicht zu sehen waren.
Besprechung im Medienhandbuch "Friedensarbeit" , Verlag Verein f. Friedenspädagogik Tübingen e.V. & Jugendfilmclub Köln e.V. 1983