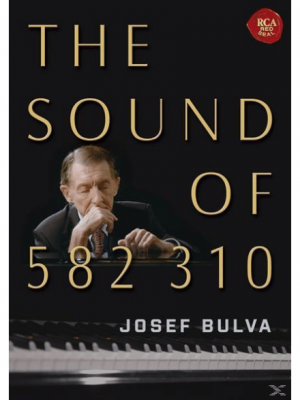Musica Viva DVD 8
€14,95
Musica Viva DVD 8
Hymnos
Der italienische Komponist Giacinto Scelsi [1905 bis 1988] zählt auch heute noch, schon bald zwanzig Jahre nach seinem Tod, zu den rätselhaftesten Erscheinungen im Musikleben des 20. Jahrhunderts. Als er Ende der 1950er Jahre nach krisenhaften Zusammenbrüchen,nach Hinwendung zu ostasiatischer Philosophie und musikalischen Exerzitien, bei denen er stundenlang nur einen Ton auf dem Klavier anschlug,um sich in dessen Obertonwelt einzuleben, dazu überging Musikstücke zu schreiben, die sich allein auf einen einzigen Ton konzentrieren,kam dies einer Revolution gleich.
Beschreibung
Hymnos
Der italienische Komponist Giacinto Scelsi [1905 bis 1988] zählt auch heute noch, schon bald zwanzig Jahre nach seinem Tod, zu den rätselhaftesten Erscheinungen im Musikleben des 20. Jahrhunderts. Als er Ende der 1950er Jahre nach krisenhaften Zusammenbrüchen,nach Hinwendung zu ostasiatischer Philosophie und musikalischen Exerzitien, bei denen er stundenlang nur einen Ton auf dem Klavier anschlug,um sich in dessen Obertonwelt einzuleben, dazu überging Musikstücke zu schreiben, die sich allein auf einen einzigen Ton konzentrieren,kam dies einer Revolution gleich.Es war freilich eine Revolution im Stillen, denn kaum jemand nahm das Außerordentliche dieser Tat wahr [Scelsis Musik wurde kaum gespielt, der Komponist blieb ohnehin im Hintergrund,verschloss sich scheu vor der Welt].
Scelsi hat einmal in einem Gespräch mit Jean-Noël von der Weidt über den Begriff Kunst in einem Satz mit eigenartiger Innenspannung angemerkt: »Kunst ist sehr einfach oder sie ist es nicht.« Und wirklich: Scelsis Musik ist so süchtig nach dem Einfachen, dass der Wunsch nach Befriedigung dieser Sucht zur höchsten Komplexität greifen muss.Immer wieder begegnen wir in seinem Werk solchen Spannweiten: Das Einfache und das Komplexe, das Kleine und das Große, die Konzentration und das Auffächern, letztlich das Eine und das Ganze. Scelsi erzählte einmal über seine Erfahrung, sich ausschließlich auf einen Ton zu konzentrieren: »Wenn man einen Ton sehr lange spielt,wird er groß.Er wird so groß,dass man viel mehr Harmonien hört,und er wird innerlich größer. Der Ton hüllt einen ein. Im Ton entdeckt man ein ganzes Universum,mit Obertönen,die man sonst nie hört.Der Ton erfüllt den Raum,in dem man ist,er umgibt einen,man schwimmt darin.« Und an anderer Stelle sagt er: »Nur wer in den Kern des Klangs vordringt, ist ein Musiker. Wem das nicht gelingt, der ist ein Handwerker. Ein musikalischer Handwerker verdient Respekt.Aber er ist kein wahrer Musiker und auch kein wahrer Künstler.«
Wer künstlerisches Tun in solch emphatischem Sinn versteht,wer so weit die Sphären des bloßen Handwerks hinter sich zu lassen trachtet, der muss all seine gestalterischen Formen dieser Idee unterordnen. Scelsi begriff den Auftrag, in den Ton und damit in sein ganzes Universum einzudringen als absoluten. Ihm gehört das ganze Interesse, das sich dadurch in ein Interesse am Ganzen wandelt. Dem so betrachteten Ton wäre qualitativ gleichwertig allenfalls die Stille entgegenzustellen. Der Ton ist sowohl die innere Zelle allen musikalischen Geschehens als auch – und das hörte Scelsi wie kaum ein zweiter Komponist – die Universalität der Musik schlechthin.
Eine Reihe von schöpferischen Fragen stellen sich an diesem Punkt – und Scelsis Musik stellt sich ihnen.Immer wieder lenkt er den Blick auf die widersprüchliche Einheit von Einzelereignis und Erfahrung des Ganzen.Da Scelsi den Ton in seiner natürlichen Gegebenheit, also spektral als Summe von Obertönen fasst, kehrt sich der Ton bzw. Klang als Spiel aus Dynamik, Rhythmik und insbesondere von Obertonverhältnissen, also von Klangfarben nach außen. Das Eine beginnt also in der Berührung mit dem Außen als Vielheit zu schillern.Hier also, in Bezug auf Einzelton und den gesamten Klangraum,die erste Dualität von Unitas und Komplexität.
Die zweite betrifft den Zeitverlauf.Denn was sich in einem Stück von Scelsi spektral in der Zeit entfaltet, gehorcht nicht einer natürlichen zeitlichen Abfolge. Eher ist es so, als ob man einen Gegenstand unter dem Mikroskop untersucht oder einen dunklen Kellerraum mit der Taschenlampe ableuchtet. Die Zeit hat ihre Ordnungskraft in vorher und nachher verloren, der Prozess des Absuchens, und dies macht die Musik Scelsis, ist zwar über die Aufführung notgedrungen in den Zeitablauf gezwungen,der Untersuchende aber weiß, dass seine subjektiv gewählte Abfolge nirgendwo dem an sich unzeitlich aufscheinenden Gegenstand adäquat ist. Ganz so wie die von der Taschenlampe beleuchtete Mauernische auch nicht später da ist,als der davor entdeckte Vorsprung. Scelsis Musik also biegt die zeitliche Verlaufsform zu einem Punkt zusammen, gleichzeitig betrachtet sie den Verlauf auch als Ausschnitt eines unendlichen Prozesses.Im Punkt ist die Unendlichkeit und wieder begegnen wir Dualität zwischen dem Einem und dem Ganzen.
Eine dritte Dualität scheint auf: die von Identität und Nicht-Identität.Wenn wir Scelsis Orchesterstücke über ausschließlich einen Ton hören,vernehmen wir ja keineswegs nur einen Ton,also nur eine Frequenz.Die Höhe schwankt – und sie kann das sogar sehr extrem tun. Der Ton also ändert seine Frequenz, ohne aber seine Identität aufzugeben. So, als würde man ein Quadrat durch ein Kräftefeld schieben, das es zum Kreis umbiegt: Wobei es dem Betrachter immer noch als Quadrat gilt.So ergeht es den Klängen Scelsis: Es gelingt ihm, auch in weiter,also nicht nur mikrotonal abweichenden Tönen gleichsam das Kräfteparallelogramm hinzuzudenken und erfahrbar zu machen,wobei zum Beispiel die Töne es, e oder f [ja sogar die Quint a] immer noch als verformter, von Deformationskräften verzerrter Ton d ausgewiesen werden.Es ist dies für das abendländische Musikverständnis bis hin zu seiner rationalistischen Inkarnation, dem Serialismus, ein undenkbares, ja ungeheuerliches Phänomen. Damit aber bringt die Musik Scelsis ein neues Paradoxon ein: eben die Identität des Nicht-Identischen.Der ganze Klangraum – und Scelsi bestreicht ihn über Obertöne wie über die eben benannten Verzerrungen gleich mehrfach – ist mit dem einzelnen Ton identisch.Das Eine ist das Ganze und das Ganze fällt auf das Eine zurück.
Ein vierter Aspekt sei noch erwähnt,er betrifft die Rolle des Komponisten.In letzter schöpferischer Konsequenz scheut Scelsi auch vor diesem Begriff zurück: Nicht nur, dass Scelsi sich nicht als schöpferisches Subjekt, sondern als übermittelndes Medium versteht, sondern weit entschiedener dadurch, dass Komponieren selbst,also das im Sinne des Wortes Zusammenstellen,vor der Wahrheit seiner Intention zurückzuweichen hat. Denn das Ganze lässt sich für Scelsi nicht zusammenstellen.Komponieren als Akt träte heraus aus der Idee der Identität des Einen mit dem Ganzen. So also empfing er Klang, übermittelte ihn – und überließ ihn dann, der ausarbeitenden Niederschrift durch einen anderen, von ihm angestellten Komponisten.Dadurch freilich stellt sich eine letzte Frage: die nach der Identität des Werkes selbst.Sie bleibt, wie alles bei Scelsi, offen. Die Vermittlung ist notwendigerweise eine gebrochene.
Hierzu freilich merkte die Cellistin Frances-Marie Uitti,die nach Scelsis Tod von den Nachlassverwaltern beauftragt wurde,die improvisierten Bänder zu digitalisieren, um sie besser zu erhalten,entmystifizierend an: »Scelsi tat, als er das Gespielte von anderen in Noten setzen ließ,im Grunde nichts anderes, als das, was heute jedes bessere Notenschreibprogramm macht. Auch dort kann man eine Phrase spielen, der Computer setzt es in Schrift, dann korrigiert oder verfeinert man.« Und ebenso wenig wie ein Computer nach dem Tod des Befehlsgebers in seinem Sinne weiter komponieren kann, so wenig vermochten es auch die Musiker,die seine Visionen in Partituren umsetzten. Die Komposition Hymnos entstand im Jahr 1963, gerade zum Höhepunkt der sehr produktiven Schaffensphase, in der Stücke über einen Ton erprobt wurden. Hymnos bedeutet Preislied oder Lobgesang und in diesem Sinne versteht sich auch diese Komposition.Sie hat zwar nur eine Länge von vielleicht zwölf Minuten, hierin aber ist sie, auch was die Besetzung [Orgel und zwei etwa gleich besetzte Orchester] betrifft, eine der grandiosesten Einzelsätze aus Scelsis Feder. Allein schon die ruhige, zwingende Gewalt des hier entwickelten Klangs lässt den Hörer wohl eine weit größere Dimensionierung des Werks abschätzen. Das subjektiv Empfundene weist entschieden über die relativ bescheidene zeitliche Ausdehnung hinaus.Hinzu freilich kommt der Eindruck,dass das Stück nur ein Segment eines immerwährenden [unhörbaren] Dröhnens ist, dass es also in dieses einblendet und auch wieder dahinter verschwindet.
Denn das ist das Gemeinte, das hymnisch Besungene. Es ist die Allgegenwärtigkeit des Klangs, ja das klingende All selbst. Ganz unmittelbar werden wir in diesem Stück von der Wucht des Alls erfasst. Scelsi beginnt mit dem Ton d, der schon in Bruckners Neunter unvergleichlich die Ruhe eines weltumspannenden Kraftzentrums meint [und gewiss hat Scelsi von dort, auch von der anschließenden Brucknerschen Kernspaltung des d in des und es, Impulse für sein ganzes Musikdenken gewonnen]. Dann aber treten die Klangerfahrungen der Moderne hinzu. Arnold Schönbergs in seiner Harmonielehre von 1911 utopisch geäußerte Vermutung, dass einmal ein Klangfarbenwechsel auf einem Ton ähnlich empfunden werden könnte, wie ein Wechsel der Tonhöhe,tritt hier [obwohl die Forderung wegen der verschiedenen sinnlichen Qualitäten von Farbe und Tonhöhe letztlich nicht einlösbar ist] wie bei keinem anderen kompositorischen Ansatz in Erscheinung.Welch Reichtum ist hier möglich! Der Ton nimmt extreme Seinzustände an, zieht wie eine Linie durch die Zeit,kommt in Bebung,dehnt und bläht sich, rüttelt an seiner Frequenzeinengung und sprengt sie mikrotonal auf, er ist hier fahl, dort gerät er in glutvolles Leuchten. So wird er zum urwüchsigen Naturereignis, wie das Auftauchen eines Meteors, wie Blitz und Donner,wie Protuberanzen der Sonne. In Hymnos schwillt der Klang gleichsam in Wellenbewegungen an, er wechselt seine harmonische Ausrichtung, geht vom d über e schließlich am Schluss zum f [auch hier Nähe zum Beginn von Bruckners Neunter!], gleichwohl bleibt der Eindruck der kontinuierlichen Anspannung des Ausgangszustands. Das Eine wird, philosophische bzw. erkenntnistheoretische Erfahrungen stehen dahinter, zum All: ein Ereignis elementarer sinnlicher Wucht.
Zu Giacinto Scelsis ›Hymnos‹ [1963]
[Reinhard Schulz]
Programmheft musica viva (03. März 2006)